Über Kälte und Wärme in einem Schulsystem voller Widersprüchlichkeiten
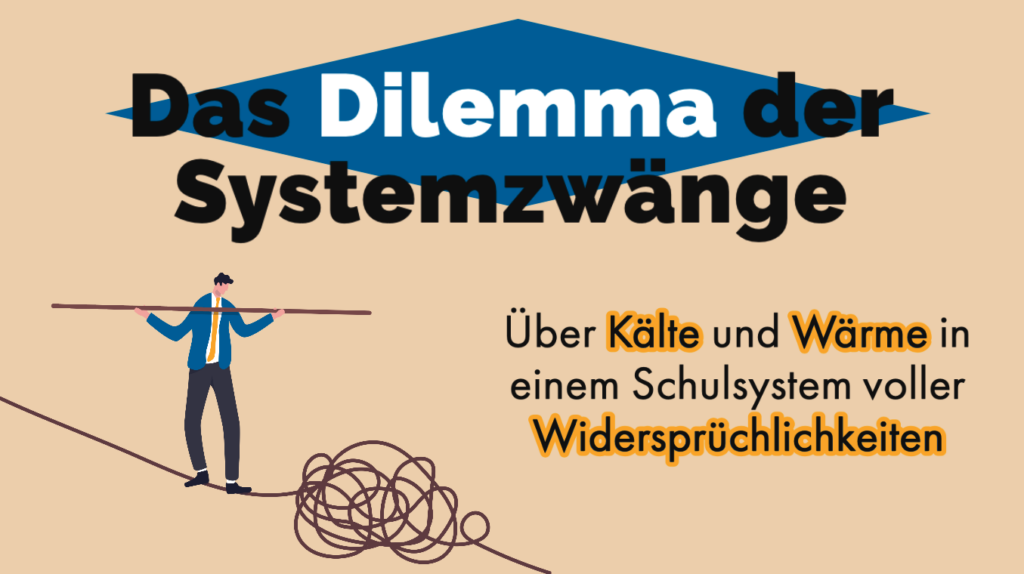
Nach Monaten des Shutdowns kann Schule im laufenden Schuljahr wieder „vor Ort“ stattfinden. Mit der Rückkehr zum Präsenzunterricht erleben wir bei einem Großteil der Lehrkräfte, Kinder und deren Familien Erleichterung und Dankbarkeit für ein Stück Normalität. Gleichwohl spüren alle Beteiligten, dass die Shutdowns der Corona-Pandemie und die mit ihr verbundenen Schulschließungen Spuren in der psychischen Gesundheit von Kindern hinterlassen haben. In der bundesweiten und repräsentativen Copsy-Studie der Forschungsabteilung Child Public Health des Universitäts-Klinikums Hamburg Eppendorf bestätigt sich dieses Gefühl. Dort ist sehr deutlich beschrieben, dass fast jedes dritte Kind ein knappes Jahr nach Beginn der Pandemie psychische Auffälligkeiten zeigt.
Diese Auffälligkeiten merken wir auch in der pädagogischen Arbeit vor Ort. Die Pandemie hat die ohnehin vorhandenen psychischen Belastungen von Kindern verstärkt, insbesondere dort, wo ein stabilisierendes privates Umfeld gefehlt hat bzw. noch immer fehlt. In unterschiedlicher Ausprägung und Häufigkeit sehen und erleben wir Formen von Depressionen, Ängsten, Selbstverletzung, Essstörungen, Aggression und Gewalt gegenüber anderen, Einsamkeit und Drogenmissbrauch. Hinzu kommen entwicklungspsychologische Herausforderungen um das Ringen mit dem eigenen Körper, Überforderung mit der Peer-Group, unklare Geschlechteridentitäten und sexuelle Orientierung sowie die Rückschläge der ersten Liebe. Und zu guter Letzt sitzen in nahezu jeder Schulklasse Kinder mit Scheidungshintergrund, Erfahrungen von Gewalt, sexuellem Missbrauch, der Trauer um Todesfälle, mit Hochsensitivität, Hochbegabung, Schulabstiegskarrieren oder Erfahrungen von Mobbing.
Unterhalb der Eisbergspitze versteckt sich eine Biografie, die gesehen werden muss
Im Unterricht sehen wir davon meist nur die Spitze des Eisbergs und manchmal nicht mal das. In vielen Fällen zeigen es Kinder nicht bewusst oder versuchen, aktiv zu verbergen, wenn es ihnen schlecht geht. Sie werden still, ziehen sich zurück, schweigen oder wenden ihre Not auf chiffrierte Art nach außen, indem sie auffällig werden, als Klassenclown um Anerkennung kämpfen oder andere fertig machen. Unterhalb der Eisbergspitze versteckt sich jedoch eine Biografie, die gehört und gesehen werden muss, damit die Schule positiv auf die Persönlichkeit und damit auch auf die Lernleistung von Schüler*innen einwirken kann. Grund-, Mittel- und Förderschullehrkräfte wissen nur zu gut, wie häufig Hilfen in und außerhalb der Schule initiiert werden müssen, um überhaupt erstmal die Grundlagen herzustellen, damit erfolgreich gelernt werden kann.
Lehrkräfte stecken in dem Dilemma, um diese Zusammenhänge zu wissen und gleichzeitig innerhalb eines inhalts- und leistungsfokussierten Systems zu arbeiten, welches sie zwingt, die individuellen Hintergründe in Teilen auszublenden. Davon sind besonders Lehrkräfte betroffen, die verschiedene Fächer in vielen unterschiedlichen Klassen unterrichten und deshalb nur wenig Zeit mit ein und derselben Lerngruppe verbringen. Ein wirkliches Kennenlernen sowie der Aufbau persönlicher Beziehungen sind dabei nur bedingt möglich. Viele von ihnen haben darüber hinaus verinnerlicht, dass gute Lehrkräfte ihre Klassen im Griff haben, ohne „Zwischenfälle“ unterrichten und Auffälligkeiten lediglich Folgen der eigenen Schwäche sind. Beide Aspekte führen automatisch dazu, dass die Disziplinierung der Lerngruppe sowie der zu vermittelnde Stoff im Fokus der Überlegungen stehen und die Menschen hinter den Schüler*innen bei der Vorbereitung und Durchführung eher weniger gesehen werden. Im schlimmsten Fall unterrichten Lehrkräfte dann über die psychischen Belange ihrer Schüler*innen hinweg und merken nicht, dass sie mit ihrem Stoff einige kaum und manche gar nicht erreichen.

Im System Schule stehen zwei Gefühlsbedingungen nebeneinander
Dieses Dilemma möchte ich als Paradoxie von institutioneller Kälte und pädagogischer Wärme beschreiben: Zwei Gefühlsbedingungen, die im System Schule nebeneinanderstehen und dies unter den gegebenen Bedingungen wahrscheinlich sogar müssen. Lehrkräfte brauchen einerseits eine empathische Zugewandtheit, um Beziehungen zu Schüler*innen aufzubauen und zu pflegen und um situativ zu handeln. Andererseits zwingt uns das Schulsystem zu einer professionellen Distanz, mit der wir uns abgrenzen, wenn wir über andere urteilen, sie bewerten, über ihre Lebenschancen entscheiden und vieles nicht tun, obwohl wir eigentlich wissen, dass es gut für dieses oder jenes Kind wäre. Ohne dies zu beabsichtigen, entsteht eine Kluft zwischen pädagogischen Ansprüchen auf individuelle Förderung der Schüler*innen und einer Kultur der ständigen Leistungsbewertung nach vermeintlich gleichen Maßstäben. Um diesen Widersprüchen Herr zu werden und um die eigenen Kräfte zu schonen, konzentrieren sich manche Lehrkräfte dann auf das bloße Halten von Unterrichtsstunden. Andere reagieren auf diesen Widerspruch, indem sie sich für einzelne Kinder aufarbeiten und so mehr Kräfte investieren, als sie langfristig aufbringen können. Wieder andere werden zynisch, resignieren oder erledigen nur noch das, was unbedingt nötig ist.
Der Spagat ist unter den bestehenden Bedingungen nur schlecht zu bewerkstelligen
Uwe Schaarschmidt hat diese Bewältigungsmuster bereits 2005 in seiner vielzitierten Potsdamer Lehrer-Studie beschrieben und auf die problematische Gesundheitssituation hingewiesen. Immerhin ließen sich alarmierende 60% der Lehrkräfte einem Risikomuster zuordnen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Spagat unter den bestehenden Bedingungen nur schlecht zu bewerkstelligen ist. Lehrkräfte kämpfen mit hohen Unterrichtsdeputaten, Lehrplan-Druck, großen Klassen, beengten Raumverhältnissen, steigenden Anforderungen und Erwartungshaltungen und schwierigem Sozialverhalten der Kinder. Der Versuch, Schüler*innen in ihren individuellen Potentialen zu erkennen und bestmöglich zu fördern, wird unter diesen Bedingungen zur Zerreißprobe. Zum einen, weil Lehrkräfte dazu vor Ort ein pädagogisches Dilemma lösen müssten (Kälte und Wärme), zum anderen, weil die systemischen Voraussetzungen Lösungen erschweren und oft sogar behindern. Gelingt der Spagat nicht, schadet es der Gesundheit der Lehrer*innen und sorgt letztlich dafür, dass wir den Kontakt zu Schüler*innen gar nicht erst finden oder verlieren. Und das, obwohl dieser Kontakt gerade jetzt von größter Bedeutung wäre.
Mitgefühl gehört zur Lehrer*innenprofessionalität
Wie können Lehrkräfte damit umgehen? Auf der persönlichen Ebene erscheint es mir zentral, an der eigenen Haltung zu arbeiten. Es geht darum, sich nicht vor den individuellen Nöten der Schüler*innen zu verschließen. Dazu braucht es Mitgefühl und die Bereitschaft, die Geschichten hinter den Fassaden zu verstehen. Lehrkräfte müssen immer wieder die Perspektive wechseln, sich selbst überprüfen und die schulische Welt aus den Augen der Schüler*innen sehen (lernen). Und das immer wieder neu, gerade dann, wenn man merkt, dass einen die Belastungen des Schulalltags einnebeln und sich innerlich eine routinierte Abgestumpftheit ausbreitet. In der Arbeit mit Menschen muss man sich berühren lassen – auf eine offene und (vor-)urteilsfreie Art und Weise, um dann die Möglichkeiten unseres Systems auszuschöpfen, so gut es geht. In den meisten Fällen heißt das: Genau hinsehen, der individuellen Angelegenheit Bedeutung einräumen, nachfragen, sich Zeit nehmen, Hilfe anbieten und Beratung hinzuziehen, Kontakt zu den Eltern aufnehmen, ein Helfer*innennetzwerk initiieren und in Kontakt zu allen Beteiligten bleiben.
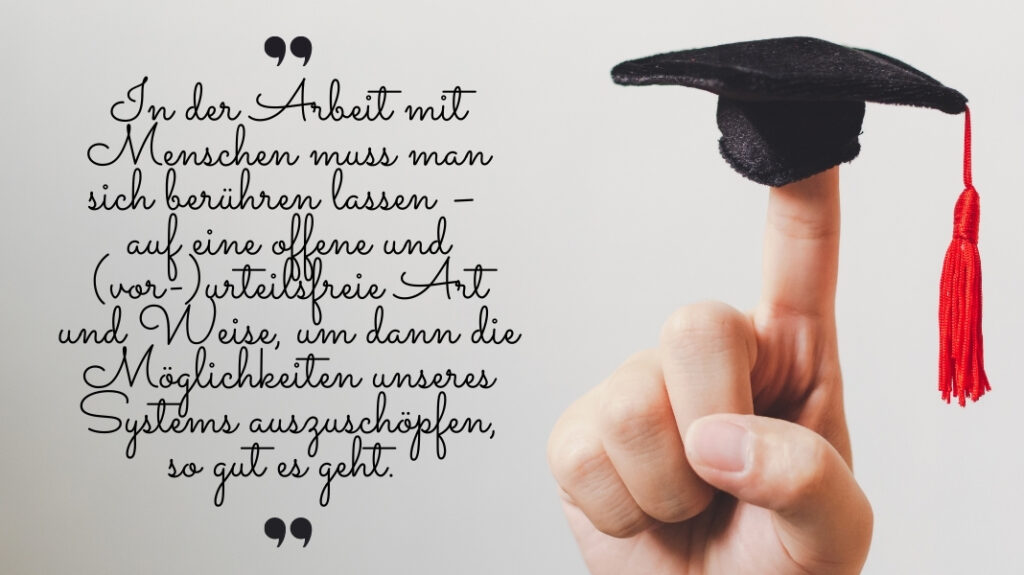
Raum für Begegnung schafft sich nicht von allein!
Das allerdings ist leichter gesagt als getan und wird allein auf individueller Ebene nicht oder nur unzureichend gelingen. Das hat auch die Bundesregierung erkannt und das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ auf den Weg gebracht. Mit zwei Milliarden Euro werden seit einiger Zeit Angebote zum Nachholen von versäumtem Lernstoff und zum sozialen Leben gemacht. Dieses Programm ist ein Schritt in die richtige Richtung, zielt aber sehr stark auf die Freizeit ab und nützt für schulische Belange höchstens zum Nachholen von Stoff bei einigen Wenigen. Darüber hinaus bräuchte es Veränderungen direkt in der Schule, die es Lehrkräften ermöglichen, mehr Zeit für den einzelnen Schüler und die einzelne Schülerin da zu sein. Mindestens für Grund-, Mittel- und Förderschulen wäre z.B. die Einführung einer Schüler*innensprechstunde ein Gewinn – fest in der wöchentlichen Stundentafel und im Deputat von Lehrkräften verankert. Zudem bräuchte es mehr Jugendsozialarbeit an Schulen, idealerweise so, dass jede Schulstufe mindestens eine*n Sozialpädagog*in zur Verfügung steht. Und natürlich wäre es von Vorteil, wenn jede Schule eine eigene Personalreserve hätte, um schwierige Klassen vorübergehend teilen zu können oder zu zweit zu unterrichten.
Wie könnte eine Schule ohne Systemzwänge aussehen?
So weit, so richtig und wünschenswert. Dennoch sind diese Vorschläge in der Denklogik des Versuchs entstanden, den oben beschriebenen Spagat besser auszuhalten. Das grundsätzliche Problem löst sich dadurch nicht. Eine Schule, die mit zugewandten Pädagog*innen unabhängig von Unterrichtsstoff und Leistung das Primat der Beziehung in den Mittelpunkt stellt, müsste gänzlich anders aufgestellt werden. Das beginnt bereits beim Personalschlüssel, der neu konstruiert werden müsste. Schüler*innengruppen bräuchten ein Team aus Lehrkräften und Sozialpädagog*innen, die für optimale Lernbedingungen sorgen. Dieses Team würde keine Klasse, sondern eine Lerngruppe begleiten, die nicht im festen Verbund unterrichtet wird, sondern altersübergreifend und ausgehend von Interessen und Fähigkeiten immer wieder andere Lerngemeinschaften hervorbringt. Alle Fachkräfte müssten nicht bloß zur Unterrichtszeit anwesend sein, sondern darüber hinaus auch Essens-, Spiele-, Praxis- und Bewegungsphasen begleiten. Selbstverständlich wären diese Zeiten fester Bestandteil ihrer pädagogischen Tätigkeit und kein Dienst on top. Zudem wäre ihr Unterricht nicht belehrend organisiert, sondern würde materialgestützte Lernbewegungen begleiten und Schüler*innen zu ihrem Vorankommen beraten. Lehrpläne würden auch am Gymnasium sehr viel offener interpretiert und mehr als „Spielfeldgrenzen“ verstanden, innerhalb derer pädagogische Freiheit herrscht. Schulbücher, die als heimlicher Lehrplan kaum bewältigbare Arbeitspensen darstellen, wären dann nur noch Unterstützungsmaterial und hätten ihren Imperativ verloren. Und Noten wären in einer systematischen und persönlichen Rückmeldekultur weitestgehend überflüssig, weil Tests nur dann Relevanz besäßen, wenn Schüler*innen eine Beurteilung wünschen oder die Schule verlassen. Der Fokus dieser Schule läge weder auf Stoff noch auf Leistung, sondern vielmehr auf Bildung in einem ganzheitlichen und humanistischen Sinne. Eine Bildung, die Schüler*innen allumfassend in ihrer Persönlichkeit sieht und zu stärken versucht – für sich selbst und für den Umgang mit anderen.
Sie finden, das klingt utopisch? Das ist es vermutlich unter den gegebenen Bedingungen der Systemzwänge auch. Gleichwohl bin ich der Meinung, dass sich Schulen diesem Zustand auch im staatlichen Schulsystem annähern können. Im Rahmen des Deutschen Schulpreises sind immer wieder Schulen wahrzunehmen, die einen solchen oder ähnlichen Weg eingeschlagen haben. Und bis sich noch mehr Schulen auf den Weg in Richtung einer solchen Bildungsutopie machen, wünsche ich mir, dass auch zwischen uns Lehrkräften mehr Gespräche über das Dilemma der Systemzwänge stattfinden. Emotional und gedanklich stecken wir doch alle in ihnen fest, auch wenn das unterschiedlich verarbeitet wird. Nach meinem Dafürhalten müsste dieses Thema bereits in der Ausbildung von Lehramtsstudierenden und Referendar*innen mehr Raum einnehmen! Damit von vornherein klar ist, dass das staatliche Schulsystem nicht ohne belastende Widersprüche auskommt. Widersprüche, deren Bewältigung eine eigene Aufgabe von Schulentwicklung ist, um Schüler*innen bestmöglich zu fördern und um die Gesundheit von Lehrkräften zu schützen.
Literatur:
Weitere Infos zur Copsy-Studie: https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html
Hattie, J./Zierer, K. (2018): Visible Learning. Auf den Punkt gebracht. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
Schaarschmidt, U. (2005). Halbtagsjobber? Psychische Gesundheit im Lehrerberuf – Analyse eines veränderungsbedürftigen Zustandes. Weinheim: Beltz. (2. Auflage)
Weitere Infos zum „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona“: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/aktionsprogramm-aufholen-nach-corona-fuer-kinder-und-jugendliche–178422
Titelbild: Nuthawut Somsuk via www.istockphoto.com; Bearbeitet von J.F.
Veröffentlicht am 13. Oktober 2021
